Scheinselbstständigkeit
Ein fest angestellter Mitarbeiter ist für den Arbeitgeber ein bedeutender Kostenpunkt. Neben dem eigentlichen Gehalt müssen für ihn hohe Sozialabgaben und Steuern entrichtet werden. Außerdem genießen Arbeitnehmer starken Schutz durch verschiedene Gesetze. Sie lassen sich häufig nur schwer entlassen und haben verschiedene Zahlungsansprüche, auch für die Zeit in der sich nicht arbeiten (Krankheit, Urlaub). Deswegen versuchen viele Unternehmer die Entstehung eines arbeitsrechtlichen Verhältnisses zu umgehen, indem sie mit ihren Beschäftigten Verträge über freie Mitarbeit eingehen.
Diese Verträge sind häufig nur projektbezogen und werden bei jedem Projekt immer wieder neu abgeschlossen. Zwar erhalten die Unternehmer damit die gewünschte Flexibilität, diese erreichen sie aber nur auf Kosten der freien Mitarbeiter. Diese befinden sich häufig in einer prekären Lage, da sie kaum ihre Zukunft planen können und ihnen jegliche finanzielle Sicherheit fehlt. Besonders davon betroffen sind die Kreativen und die IT-Branche.
Ob jemand aber wirklich nur ein freier Mitarbeiter ist oder doch ein Arbeitnehmer, richtet sich nicht nach der Bezeichnung im Vertrag, sondern nach der „gelebten“ Wirklichkeit der Zusammenarbeit. Das Stichwort hier heißt Scheinselbständigkeit.
Auf dieser Seite erfahren Sie alles Wissenswerte zu diesem Phänomen. Wir erläutern Ihnen, wie man eine Scheinselbständigkeit feststellen kann, welche Folgen diese nach sich zieht und welche Rechte Ihnen als Scheinselbständiger zustehen.
Was versteht man unter Scheinselbständigkeit?
Scheinselbständige sind in Wirklichkeit Arbeitnehmer. Zwar werden sie formal als Selbständige, freie Mitarbeiter oder auch freelancer bezeichnet, tatsächlich handelt es sich aber nicht um eine freie Zusammenarbeit, sondern um eine abhängige Beschäftigung. Die Selbständigkeit besteht nur zum Schein nach außen, die Bedingungen unter denen die Arbeit in Wirklichkeit verrichtet wird, entsprechen Bedingungen in einem Arbeitsverhältnis.
Eine solche Konstruktion wird aus verschiedenen Gründen gewählt. Einerseits wollen die „Auftraggeber“ keine arbeitsrechtlichen Verpflichtungen eingehen (Kündigungsschutz, Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, Gewährung bezahlten Urlaubs u.a.), andererseits wird auf diese Weise versucht Sozialversicherungsbeiträge und Steuern zu sparen. Besonders häufig kommt Scheinselbständigkeit in der IT-Branche vor.
Jan Glitsch ist Anwalt für Arbeitsrecht und betreut mit seinem spezialisierten Team bundesweit unsere Mandanten in diesem Bereich.
Inhalt dieser Seite:
- Was versteht man unter Scheinselbständigkeit?
- Wann ist man scheinselbständig?
- Welche arbeitsrechtlichen Folgen hat die Scheinselbständigkeit?
- Welche sozialversicherungsrechtlichen Folgen hat die Scheinselbständigkeit?
- Welche steuerrechtlichen Folgen hat die Scheinselbständigkeit?
- Wie wird eine Scheinselbständigkeit festgestellt?
- Was kann man tun, wenn die Aufträge ausbleiben?
- Kann man als Scheinselbständiger eine Abfindung erhalten?
- Besteht bei Scheinselbständigkeit ein Anspruch auf Arbeitslosengeld?
- Wer sind arbeitnehmerähnliche Selbständige?
- Kostenlose Erstberatung



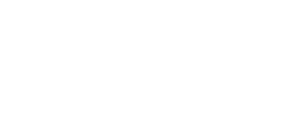

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich bin mir nicht sicher, ob Sie mir mit meinem Anliegen weiterhelfen können. Deshalb schildere ich Ihnen einfach mal meinen Fall und wäre über eine kurze Rückmeldung froh, um zu sehen, ob wir zusammen arbeiten können.
Die Sache ist wie folgt. Seit letztem Jahr bin ich freiberuflich hauptsächlich als Gutachter für Organisationen der internationalen Entwicklungszusammenarbeit tätig. Ich erstelle Menschenrechtsanalysen, untersuche den politischen Kontext und die daraus für Entwicklungsprojekte eventuell resultierenden Risiken für das Projekt, sowie Genderanalysen.
Ich habe vorher bei der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) in Brasilia als Entwicklungshelfer gearbeitet (bis Mai 2020). Als Folge daraus kenne ich mich natürlich mit den internen Prozessen der GIZ am besten aus, was dazu führt, dass die meisten (aber nicht alle) meiner Aufträge und der Großteil (aber nicht alles) der Einnahmen von der Firma kommen, bei der ich vorher angestellt war. Nach meinen Recherchen im Internet ist man in dieser Situation dem Risiko ausgesetzt als Scheinselbstständig eingeschätzt zu werden. Für mich ist das Risiko sogar noch unmittelbarer, da die GIZ vor jedem Auftrag eine Eigenerklärung verlangt, in der ich als Gutachter zusichern muss in den letzten und in den nächsten 12 Monaten nicht mehr als 5/6 meiner Einnahmen von der GIZ zu beziehen.
Auf der anderen Seite spricht natürlich gegen eine Scheinselbständigkeit, dass ich a) noch andere Einnahme-Quellen habe (ich arbeite als Übersetzer und Author für eine französische Zeitschrift), b) schon einen Auftrag von einer anderen Firma bekommen habe, c) einen eigenen Webauftritt habe und regelmäßig auch (bisher bis auf einmal leider erfolglose) Angebote an andere Firmen schicke (also mich aktiv um andere Aufträge bemühe). Mit dem großen Auftrag der anderen Firma, sowie mit den Einnahmen aus den Texten/Übersetzungen, bin ich bisher noch ein bisschen von der 5/6 Grenze entfernt, nehme also mehr als 1/6 aus nicht-GIZ-Quellen ein. Da gerade viele Aufträge der GIZ reinkommen und gleichzeitig die anderen Einnahmen relativ gering bleiben, bin ich aber besorgt, wie nachhaltig das Konstrukt auf lange Sicht ist.
Ich hatte die Überlegung, ob es sich lohnt ein Unternehmen zu gründen (eine UG, zum Beispiel) und dann einen Teil der Aufträge über die UG abzuwickeln (die natürlichen unter meinem Namen laufen würde, aber rechtlich ja doch eine andere Einheit ist, als ich als freiberufliche Privatperson) und den anderen Teil als Freiberufler zu machen. Soweit ich weiß macht die GIZ Geschäfte sowohl mit Freiberuflern, als auch mit Gutachter-Firmen. Meine Firma würde mir in diesem Modell ein Gehalt auszahlen. Damit hätte ich Aufträge von der GIZ und von der (meiner) Consulting-Firma, zusätzlich zu den Einnahmen aus den Übersetzungen/Texten. Das hätte für mich eventuell noch mehr Vorteile (z.B. die Möglichkeit weiter im Gutachtergeschäft mit der GIZ zu bleiben, auch wenn ich möglicherweise in Zukunft eine Festanstellung in der GIZ ergattern kann).
Daneben gibt es noch die Situation, dass manche meiner Einnahmen aus der GIZ-Zentrale in Deutschland kommen und andere aus der GIZ Brasilien. Ich bin mir nicht sicher, ob das rechtlich gesehen vielleicht zwei komplett unterschiedliche Einheiten sind und damit die ganze Panik von vornherein unnötig ist. Die brasilianischen Aufträge rechne ich als brasilianische Person mit brasilianischer Steuernummer etc. ab (ich bin in Brasilien permanent resident), hat also zumindest steuerlich überhaupt nichts mit Deutschland zu tun.
Ich müsste also klären, ob:
1. Ich überhaupt in Gefahr bin als scheinselbstständig eingeschätzt zu werden?
2. Die Idee der Firmengründung eine Lösung dafür bietet?
3. ob GIZ Deutschland und GIZ Brasilien die selbe Firma sind oder zwei unterschiedliche und ob die “transkontinentalen Einnahmen zählen, um Scheinselbsständigkeit zu vermeiden?
Könnten Sie mir bei diesen Fragen helfen? Wenn ja, könnten wir einen Termin zur Beratung vereinbaren?
Beste Grüße aus Brasilia,
Fabian W.
Sehr geehrter Herr W.,
vielen Dank für Ihre Anfrage. Gerne kann ich Ihnen einen Beratungstermin hierzu anbieten.
Bitte nutzen Sie im ersten Schritt unser Kontaktformular.
Mit freundlichen Grüßen
J. Glitsch
Rechtsanwalt