Realsicherheiten
1. Sicherungsübereignung
Die Sicherungsübereignung meint in der Regel den Fall, dass der Schuldner eine Leistung vom Gläubiger nur dann erhält, wenn der Schuldner zur Sicherheit eine Sache übereignet. Ein typisches bildet der Fahrzeugkauf. Wendet sich der Schuldner für die Finanzierung eines Autokaufs bei einer Bank, dann wird diese das angefragte Darlehen auszahlen, wenn der Schuldner seinerseits bereit ist, dass gekaufte Fahrzeug der Bank zur Sicherheit zu übereignen. Der Schuldner bleibt im Besitz des Fahrzeuges und kann die Rückübereignung des Fahrzeugs dann beanspruchen, wenn das Darlehen zurückgezahlt wurde. Fällt die Darlehensrückzahlung aufgrund von Zahlungsschwierigkeiten beim Schuldner aus, kann die Bank das Fahrzeug verwerten, um sich schadlos zu halten.
Für weitere Informationen verweisen wir auf unseren Beitrag zum Sicherungseigentum.
2. Pfandrecht
Während das Sicherungseigentum ein besitzloses Pfandrecht darstellt, ist in den §§ 1204 ff. BGB das besitzverbundene Pfandrecht geregelt. Der Gläubiger bekommt für seine gewährte Leistung ein Pfand, über den er die tatsächliche Sachherrschaft ausübt, bis der Schuldner die gewährte Leistung ausgleicht. Sollte der Schuldner hierzu nicht in der Lage sein, kann der Gläubiger auf das Pfandrecht zugreifen, es verwerten und den Erlös zur Befriedigung seiner Forderung verwenden. Da sich das Pfand gleichsam „in der Hand“ des Gläubigers befindet, spricht man auch vom sogenannten Faustpfandrecht.
Es gibt aber neben dem beschriebenen vertraglichen Pfandrecht auch gesetzliche Pfandrechte. Dazu zählen z.B. das Pfandrecht für den Vermieter, Gastwirt oder Werkunternehmer.
Eine Sonderform bildet das Pfändungspfandrecht. Das Pfändungspfandrecht entsteht zugunsten des Gläubigers, wenn eine Sache zum Zwecke der Zwangsvollstreckung beschlagnahmt wird (Verstrickung). Dieser erwirbt damit das Recht zu Verwertung der beschlagnahmten Sache zur Befriedigung seiner Forderung gegen den Schuldner. Der aus Verwertung erzielte Erlös wird dem Gläubiger ausgekehrt, der durch das Pfändungspfandrecht ebenfalls die Berechtigung erhält, den erhaltenen Erlös behalten zu dürfen.
3. Eigentumsvorbehalt
Im Wirtschaftsleben absolute gängige Praxis ist der Eigentumsvorbehalt. Wird der Schuldner vom Gläubiger beliefert, kauft der Schuldner etwas auf Rechnung oder erwirbt der Schuldner eine Sache, die noch nicht vollständig bezahlt ist, behält sich der Verkäufer in der Regel das Eigentum an der Sache bis zur vollständigen Kaufpreiszahlung vor.
Dieser Umstand ist vielen Verbrauchern gar nicht bewusst. Solange Sie den Kaufpreis nicht endgültig bezahlt haben, bleibt das Eigentum beim Verkäufer. Sie haben in der Zwischenzeit ein sogenanntes Anwartschaftsrecht. Schauen Sie beim nächsten Einkauf auf die Rückseite Ihres Kassenbons oder in die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Händlers. Dort finden Sie mit Sicherheit eine solche Vereinbarung.
Hintergrund des Eigentumsvorbehalts ist auch eine Form der Kreditsicherung. Denn solange eine geschuldete Zahlung aussteht, lässt sich von einem Kredit sprechen, der abgesichert wird, indem das Eigentum beim Verkäufer verbleibt. Kann der Schuldner den Kaufpreis wider erwarten doch nicht zahlen, kann der Verkäufer aus § 985 BGB Herausgabe der Sache verlangen. Ebenso ein Recht auf Herausgabe hat der Verkäufer bei einer Insolvenz des Schuldners, da das vorbehaltene Eigentum ein Recht auf Aussonderung gibt.
4. Sicherungszession/ Globalzession
Die Sicherungs- oder Globalzession ist auch ein Mittel, um eine Forderung abzusichern. Denn hierbei tritt der Schuldner seine Forderungsrechte gegenüber Dritten an den Gläubiger ab. Dieser darf dann die Rechte des Schuldners in eigenem Namen gegen die Dritte geltend machen, falls der Schuldner nicht mehr in der Lage ist, seine gegenüber dem Gläubiger bestehende Schuld zu bedienen.
Näheres hierzu im Beitrag Globalzession.
5. Grundschuld
Die Grundschuld lässt sich auch als Grundpfandrecht bezeichnen. Sie gibt dem Inhaber der Grundschuld einen Anspruch auf Duldung der Zwangsvollstreckung (§ 1147 BGB) in das Grundstück des Grundstückseigentümers. Die Grundschuld wird in der Praxis in der Regel zur Absicherung einer Forderung bestellt. Kann die abgesicherte Forderung nicht bedient werden, tritt der Sicherungsfall ein und der Gläubiger – oftmals eine Bank – kann die Zwangsvollstreckung in das Grundstück betreiben.
Damit ist Grundschuld vergleichbar mit der Hypothek, wobei Sie dem Wesen nach nicht vom Bestand der abgesicherten Forderung abhängt (Abstraktheit der Grundschuld). Daher besteht eine Grundschuld zunächst fort, selbst wenn die abgesicherte Forderung getilgt wurde. Der Besteller der Grundschuld hat aber aus dem zugrunde liegenden Sicherungsvertrag einen Anspruch auf Rückübertragung der Grundschuld.



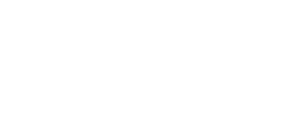

Dein Kommentar
An Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns Deinen Kommentar!