Abberufung, Kündigung und Amtsniederlegung
Ein Wechsel in der Position oder ein Ausscheiden des Geschäftsführers ist ein einschneidender Moment in einer Gesellschaft. Doch bei Meinungsverschiedenheiten mit Gesellschaftern über grundsätzliche Richtungsfragen der Gesellschaft kann mitunter ein erzwungener Wechsel notwendig sein. Auch ein freiwilliger Abschied aus Altersgründen oder zur Suche einer neuen Herausforderung ist möglich. Der Geschäftsführer kann sein Amt auch von sich aus niederlegen.
Anders als bei anderen Angestellten ist bei Geschäftsführern in diesem Zusammenhang immer zweierlei zu unterscheiden:
- die gesellschaftsrechtlich Seite, also die Beendigung der Organstellung des Geschäftsführers, etwa durch Abberufung oder Amtsniederlegung und
- die arbeitsrechtliche Seite, also z.B. die Kündigung seitens der Gesellschaft oder des Geschäftsführers bzw. der Abschuss eines Aufhebungsvertrages.
Die Abberufung beendet die Organstellung des Geschäftsführers. Sie wird mit Eintragung ins Handelsregister nach außen hin wirksam. Die Abberufung kann i.d.R. ohne Angabe von Gründen oder aber aus einem wichtigen Grund erfolgen. Damit einher gehen regelmäßig eine Kündigung des Anstellungsvertrages oder der Abschluss eines Aufhebungsvertrages.
Abberufung des Geschäftsführers
Für den Fall einer Abberufung durch die Gesellschafter ist die Gesellschafterversammlung das zuständige Organ. Es spricht die Abberufung aus.
Aufgrund des Trennungsprinzips bedeutet eine Abberufung zwar das Ende der Organstellung, nicht jedoch das Ende des Anstellungsverhältnisses.
Regelmäßig ist daher außerdem der Anstellungsvertrag zu kündigen, z.B. fristlos aus wichtigem Grund und hilfsweise ordentlich zum Ende der Kündigungsfrist. Es kann auch ein Aufhebungsvertrag geschlossen oder von vornherein eine sogenannte Koppelungsklausel vereinbart sein, infolge derer das Anstellungsverhältnis gleichzeitig mit der Abberufung erlischt.
In aller Regel fasst die Gesellschafterversammlung aber parallel zur Abberufung einen Gesellschafterbeschluss über die Kündigung des Geschäftsführervertrags.
Abberufung ohne besonderen Grund
Grundsätzlich kann der Geschäftsführer jederzeit abberufen werden (§ 38 Abs. 1 GmbHG). Für die Abberufung eines Geschäftsführers muss auch kein besonderer Grund angegeben werden. Die Gesellschafterversammlung kann über sie vielmehr i.d.R. mit einfacher Mehrheit ohne Angabe von Gründen beschließen. Abweichende Regeln gelten für paritätisch mitbestimmte GmbHs.
Abberufung aus wichtigem Grund
Im Geschäftsführervertrag kann allerdings auch geregelt sein, dass eine Abberufung nur aus wichtigem Grund erfolgen kann. Ein solcher wichtiger Grund liegt in den folgenden Fällen vor:
- eine grobe Pflichtverletzung durch den Geschäftsführer vorliegt
- dessen Unfähigkeit zur Geschäftsführung gegeben ist
- Verletzung der Insolvenzantragspflicht
- Verdachtskündigung bei strafbaren Handlungen (Wichtig: Anhörung des Geschäftsführers ist Wirksamkeitsvoraussetzung)
- Ausnutzen von Geschäftschance der Gesellschaft zum eigenen Vorteil
- Verrat von Geschäftsgeheimnissen
- Unberechtigte Amtsniederlegung zur Unzeit
- Verstoß gegen ein Wettbewerbsverbot
- Verwendung von Materialien der Gesellschaft für private Zwecke
- Verstoß gegen Weisungen der Gesellschafter
Dabei kommt es nicht auf ein Verschulden des Geschäftsführers an sondern lediglich darauf, dass ein Verbleib in der Organstellung unter Berücksichtigung der Interessen der Gesellschaft unzumutbar ist.
Verwirkung des Abberufungsrechts
Wenn die Gesellschafterversammlung sich nicht schnell nach Vorliegen des wichtigen Grundes zur Abberufung entscheidet, kann durch das Tolerieren des Verhaltens des Geschäftsführers das Recht zur Abberufung verwirkt werden. Im Gegensatz zur Bestellung des Geschäftsführers darf ein Geschäftsführer, der Stimmrechte in der Gesellschafterversammlung besitzt, nicht über seine eigene Abberufung mitbestimmen.
Handelsregistereintrag maßgeblich
Der Eintrag des Geschäftsführers im Handelsregister bleibt Dritten gegenüber wirksam, zumindest wenn diese nichts von der Abberufung des Geschäftsführers wussten. Solange also kein neuer Geschäftsführer ins Handelsregister eingetragen ist, kann der alte Geschäftsführer weiterhin wirksam nach außen handeln.
Amtsniederlegung durch den Geschäftsführer
Andersherum kann auch der Geschäftsführer grundsätzlich jederzeit sein Amt niederlegen. Hierfür muss er jedoch die Interessen der Gesellschaft berücksichtigen. Beispielsweise eine Amtsniederlegung in der Krise, in der Sanierungshandlungen oder sogar die Anmeldung eines Insolvenzantrags durchgeführt werden müssten, stellt eine unzulässige Amtsniederlegung zur Unzeit dar. Die Erfordernisse zur Amtsniederlegung des Geschäftsführers sind im Gesellschaftsvertrag näher bestimmt. Ist dort nichts geregelt, so reicht eine Erklärung gegenüber der Gesellschafterversammlung.
Parallel zu Amtsniederlegung ist auch der Geschäftsführervertrag mit der GmbH zu kündigen. Das Dienstverhältnis zwischen dem Geschäftsführer und der Gesellschaft kann aber auch durch einen Aufhebungsvertrag beendet werden.
Aufhebungsvertrag
Das Dienstverhältnis zwischen dem Geschäftsführer und der Gesellschaft kann auch durch einen Aufhebungsvertrag beendet werden. Inhalt des Aufhebungsvertrags kann folgendes sein:
- Regelung des Beendigungszeitpunktes
- Nennung des Beendigungsgrundes
- Noch anfallende oder offene Entgeltansprüche
- Haftungsfreistellungen
- Abgeltung von nicht genommenem Urlaub
- Abfindungszahlungen
- Auflösung oder sonstige Regelungen zur betrieblichen Altersvorsorge
- Wettbewerbsverbot
- Verschwiegenheitspflichten
- Regelungen über Gegenstände der Gesellschaft wie Diensthandy, Notebook, Dienstwagen
- Salvatorische Klausel
Der Auflösungsvertrag muss nicht schriftlich geschlossen werden, denn § 623 BGB findet auf Geschäftsführeranstellungsverträge keine Anwendung. Dennoch ist das schriftliche Festhalten seiner Ergebnisse sehr empfehlenswert. Ungültig ist ein Auflösungsvertrag, wenn er an eine Bedingung geknüpft ist, beispielsweise Umsatzkennziffern oder Krankheitstage


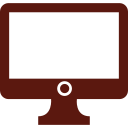
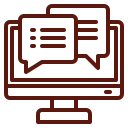








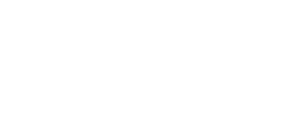

Dein Kommentar
An Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns Deinen Kommentar!