Unternehmen, die zur Erstellung eines Jahresabschlusses verpflichtet sind, schütten auch Gewinne an Gesellschafter oder Aktionäre aus. Dabei kommen unterschiedliche Regelungen zum Tragen, die es zu beachten gilt.
Gesetz oder Satzung sind maßgebend
Wenn keine außerordentliche Regelung in der Satzung festgelegt wurde, gelten die Regelungen des Gesetzes. Für die GmbH und UG bedeutet das, dass die Gewinnverteilung nach Unternehmensanteilen stattfindet. Besitzt ein Gesellschafter 25% des Unternehmens, so hat er ein Anrecht auf 25% des Gewinns nach Steuern.
Wird in der Satzung hingegen etwas anderes festgelegt, so spricht man von einer inkongruenten Gewinnverteilung. Manche sprechen auch von einer disquotalen Gewinnverteilung.
Unternehmensanteilige Gewinnverteilung
Die unternehmensanteilige Gewinnverteilung sieht vor, dass Gesellschafter einen Anteil des Gewinns in Höhe ihrer prozentualen Beteiligung am Unternehmen erhalten. Besitzt ein Gesellschafter 50% an einer GmbH, die einen Gewinn nach Steuern von 100.000€ erwirtschaftet hat, erhält er 50.000€. Ein anderer Gesellschafter hat 20% und erhält deshalb 20.000€. Ein dritter 30% und dementsprechend 30.000€.
Inkongruente Gewinnverteilung
Mittlerweile hat die GmbH eine inkongruente Gewinnverteilung durch Änderung der Satzung eingeführt. Alle drei Gesellschafter erhalten im nächsten Geschäftsjahr bei einem Gewinn von 150.000 €, jeweils 50.000€ ausgezahlt.
Berechnung der Kapitalertragssteuer
Gesellschafter müssen auf ihre Erträge aus der Beteiligung von Kapitalgesellschaften Kapitalertragssteuer zahlen, die auch Abgeltungssteuer bezeichnet wird. Da sie bei jedem Gesellschafter einzeln anfällt, beeinflusst sie nicht das Betriebsergebnis vor oder nach steuerlichem Abzug. Die rechtliche Grundlage findet sich in §§ 44 ff. EStG.
Der Basissatz der Kapitalertragssteuer beträgt 25%. Allerdings werden auch hierauf der Solidaritätszuschlag sowie die Kirchsteuer hinzugefügt.
- Ohne Kirchsteuer: 26,735%
- 8% Kirchsteuer: 27,8186%
- 9% Kirchsteuer: 27,9951%
Alternative: Teileinkünfteverfahren
Gesellschafter könnten auf die Kapitalertragssteuer verzichten. Dafür kann das Teileinkünfteverfahren angewandt werden. Allerdings muss der Gesellschafter 25 Prozent einer UG oder einer GmbH besitzen (§ 32 EStG). Zudem muss das Verfahren beim Finanzamt beantragt werden.
Der Gesellschafter kann auf die Abführung der Kapitalertragssteuer verzichten, wenn er 60% der Gewinnausschüttung in Höhe seines Einkommenssteuersatzes versteuert.
Zudem kann der Gesellschafter eine „Günstigerprüfung“ beantragen. Das Finanzamt prüft, welche Methode die geringere Steuerlast mit sich bringt und verwendet dann diese.
Keine verdeckte Gewinnausschüttung zulässig
Keineswegs dürfen Gewinne bei Kapitalgesellschaften oder Mischform verdeckt ausgeschüttet werden. Eine verdeckte Gewinnausschüttung wäre ein Geldfluss an die Gesellschafter, ohne dass diese steuerrechtlich erfasst und dementsprechend versteuert werden. Häufig geschieht dies auch unwissentlich.
Typische Fälle der verdeckten Gewinnausschüttung sind:
- Geschäftsführergehalt über das angemessene Maß hinaus
- Zinslose Kredite an Gesellschafter
- Private Nutzung von Sachanlagen, wie Fahrzeugen
- Finanzierung privater Feiern
Drei Möglichkeiten der Gewinnverwendung
Eine handelsrechtliche Firma hat in der Regel drei Optionen zur Gewinnverwendung:
- Gewinnausschüttung
- Gewinnvortrag
- Gewinnrücklage
Die Gewinnausschüttung wurde bereits behandelt. Der Gewinnvortrag wäre eine Übernahme des Jahresüberschusses ins nächste Geschäftsjahr. Die Bildung von Gewinnrücklagen kann teilweise sogar vorgesehen sein.
Besonderheiten der UG
Die UG ist zur Bildung einer Pflichtrücklage in Höhe von 25% verpflichtet, bis sie ein Stammkapital von 25.000 € angespart hat. Dementsprechend kann sie nur 75% des Gewinns verteilen. Wird keine Rücklage gebildet, so ist der Jahresabschluss unzulässig und der Geschäftsführer haftet persönlich. Bereits ausgeschüttete Gewinne müssen zurückgezahlt werden.
Gewinnverwendungsbeschluss
Der Gewinnverwendungsbeschluss wird in der Gesellschafterversammlung gefällt und zwar zum Ende des Geschäftsjahres. Beachtet werden muss, dass durch die Verteilung des Gewinns das Stammkapital nicht unterschritten wird.
Muss das Unternehmen einen Anhang erstellen, ist das Ergebnis des Beschlusses im Anhang zu veröffentlichen.


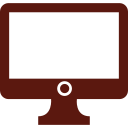
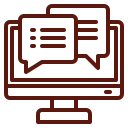














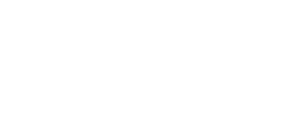

Dein Kommentar
An Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns Deinen Kommentar!